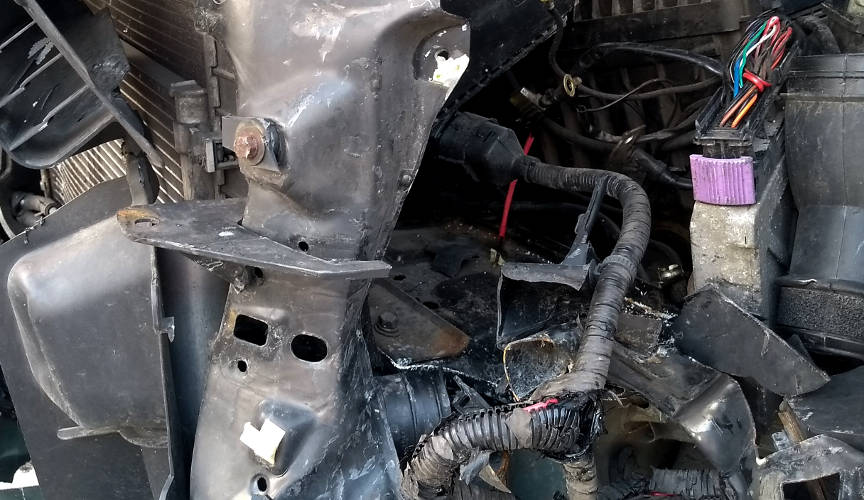Die Corona-Krise ist der ultimative Stresstest – auch für den Journalismus. Während der Bedarf an zuverlässiger Information so hoch ist wie nie zuvor, schicken Verlage ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit. Gleichzeitig verabschiedet sich eine wachsende Zahl an Bürger*innen komplett aus dem faktenbasierten Diskurs. Notprogramme werden nicht reichen. Es ist Zeit für einen Neuanfang.
von Frederik Fischer, Leonard Novy and Alexander Sängerlaub, 15.5.20
Die Corona-Krise ist der ultimative Stresstest – auch für den Journalismus. Während der Bedarf an zuverlässiger Information so hoch ist wie nie zuvor, schicken Verlage ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit. Gleichzeitig verabschiedet sich eine wachsende Zahl an Bürger*innen komplett aus dem faktenbasierten Diskurs. Notprogramme werden nicht reichen. Es ist Zeit für einen Neuanfang. Die Folgen der Corona-Krise treffen uns alle hart. Das betrifft auch jene Akteure, die uns gerade in Zeiten von Social Distancing Informationen, Orientierung und ein Gefühl des Zusammenhalts in die Isolation unserer Wohnungen liefern. Der Ausnahmezustand hat uns gezeigt, dass nicht nur Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte oder Supermarktangestellte systemrelevant sind, sondern auch der Journalismus. Davon zeugen die Zugriffsrekorde der Verlage, aber auch die öffentlich-rechtlichen Sender, die mit ungeahnter Flexibilität und Innovationsfreude auf die Krise reagierten, wie nicht nur der NDR-Podcast mit Christian Drosten belegt.
Traffic-Wachstum und journalistische Meriten – das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite stehen kollabierende Werbemärkte, Sparprogramme und Kurzarbeit – und das in einer Branche, in der befristete Verträge an der Tagesordnung sind und Freiberufler sich oft von Artikel zu Artikel hangeln. Viele regionale Nachrichtenhäuser standen schon vor Corona mit dem Rücken zur Wand. Corona verstärkt die Probleme einer Branche, die im Digitalen noch immer auf der Suche ist: Nach Finanzierungsmodellen, funktionierenden Erzählformaten und ihrem Publikum. Letzteres wiederum wird zusehends woanders fündig: Krude Verschwörungstheoretiker haben Hochkonjunktur auf den sozialen Netzwerken und YouTube. Dort wo keine Tageszeitung mehr im Haus ist, googelt man eben die Nachrichten. Manchmal mit zweifelhaftem Ausgang.
Probleme des Journalismus im Brennglas
Mit dem Rückzug der alten Gatekeeper, dem Vormarsch der Plattformen und der daraus entstandenen Prosumenten-Öffentlichkeit sind uns zahlreiche Probleme ins Haus geflattert, die uns in der Krise noch einmal verschärft wie unter dem Brennglas erscheinen.
Dabei ist eine tragende Erkenntnis dieser Tage, dass die systemrelevanten Berufe nicht länger alleine den Marktkräften überlassen werden dürfen, das sehen wir eben nicht nur im Gesundheitssystem. Im Journalismus kann eine auf Werbung verzichtende Qualitätszeitung nicht einmal im rechtlichen Sinne »gemeinnützig« sein – warum eigentlich nicht? Wer sich ohne die algorithmische Aufmerksamkeitsökonomie datengetriebener, amerikanischer Plattform vernetzen und informieren möchte, hat dabei keine relevante Alternative – warum nicht? Wer nach Informationen auf mehreren Nachrichtenseiten sucht, strandet ständig vor den Paywalls. Immer noch gibt es kein gemeinsames Angebot der Verlage? Warum nicht? In der ganzen Branche fehlen Gelder für qualitativ hochwertigen, investigativen und Wissenschaftsjournalismus und die Digitalkonzerne zahlen nicht mal Steuern? Warum nicht? Klar, auf alle diese Fragen gibt es Antworten, aber greifen die Argumente von gestern auch heute noch? Das darf getrost bezweifelt werden.
Viel wird in diesen Tagen über Rettungs- und »Stimulus-Pakete« diskutiert. Und natürlich stehen auch der überwiegend mittelständisch geprägten Medienbranche staatliche Nothilfen zu. Doch wer sich als Politiker*in nun über die Rettung der Medienhäuser in der Corona-Krise Gedanken macht, sollte doch etwas größer denken. Es geht eben absehbar nicht nur darum, die Verleger vor der Krise zu retten, sondern darum, die Gesellschaft vor einem Kollaps der pluralen Öffentlichkeit. Wen oder was sollten wir überhaupt retten? So wie in Österreich ursprünglich angedacht vor allem reichweitenstärksten Blätter und damit vor allem die Boulevardzeitungen? So sollte das Brennglas der Krise uns Anlass genug sein, sich über die ein paar Grundfragen zu beugen: Wie wollen wir uns als Gesellschaft informieren? Was braucht es dafür? Wie schaffen wir eine demokratische, diskursorientierte, plurale Öffentlichkeit?
Dafür braucht es sicherlich vieles nicht mehr: Die unnötigen Grabenkämpfe zwischen öffentlich-rechtlichem System und der privaten Pressewirtschaft zählen dazu. Auch braucht es keinen Journalismus als digitale Content-Schleuder, dessen Aufmerksamkeitsökonomie sich nur rudimentär von der der sozialen Netzwerke unterscheidet.
Kooperation statt Konkurrenz, Gemeinwohl statt Markt
Welche Bedürfnisse nach Information, Bildung und gesellschaftlicher Selbstverständigung können eben nur durch Journalismus und nicht durch Tech-Unternehmen im Silicon Valley abgebildet werden? Gemeinwohlorientierung, Kooperation, Experimentierfelder heißen die Zauberworte einer neuen Medienordnung, in denen eine kluge Medienpolitik im Bestfall Möglichkeitskeitsräume eröffnet, statt verbaut
Dabei werden öffentlich-rechtlichen Medien auch in Zukunft eine zentrale Rolle zuteil – vielleicht mit einem neuen Grundauftrag, der den Bedarfen und Herausforderungen des digitalen Zeitalters eher entspricht: Wie dem Wunsch nach Vernetzung. Gäbe es die Öffentlich-Rechtlichen nicht, man müsste sie heute erfinden. Weil man sie nicht einfach neu erfinden kann, braucht es Reformen, gewissermaßen bei laufendem Motor. Dabei gibt es verfassungsrechtlich beispielsweise keinen zwingenden Zusammenhang zwischen dem öffentlich-rechtlichen Gedanken und der etablierten Senderstruktur. In Großbritannien können Regionalzeitungen mit Recherchevorhaben sich um Unterstützung der BBC bewerben, die dann eigene Mitarbeiter entsendet und dafür die Kosten trägt. Auch ein aus dem Beitragsaufkommen finanzierter Recherche-Fonds für die gezielte Unterstützung gesellschaftlich relevanter Arbeit wäre für Deutschland ein interessantes Modell.
Die medienpolitische Gretchenfrage
Wie sehen sie aus, die analogen und digitalen Informationsarchitekturen der liberalen Demokratien von morgen und was können wir aus den ersten Fehlschlägen des Social-Media-Zeitalters und der damit zusammenhängenden Übermacht von Desinformation, Hate Speech, Verkürzung und Propaganda lernen? Welche Fähigkeiten brauchen wir als mündige Bürgerinnen und Bürger in diesen neuen, komplexeren Medienräumen und wer vermittelt sie uns? Welche neuen Formen des digitalen Erzählens verheißt uns der konstruktive Journalismus und kann die entscheidende Frage dann nur sein, wie sich damit auch Geld verdienen lässt – oder darf es uns als Gesellschaft gerne etwas kosten?
All diese Fragen sollten uns viel Zeit und Raum wert sein, sich ihnen zu widmen und dabei Diversität, Pluralismus und Nachhaltigkeit direkt mitzudenken: gern explorativ, gern agil, gern interdisziplinär. Die publizistische Versorgung der Gesellschaft mit qualitativ hochwertigem Journalismus ist eben keine Selbstverständlichkeit. Aber sie ist eine demokratische Notwendigkeit. Wenn sich die aktuellen Tendenzen fortsetzen, wachen wir irgendwann auf und unserer Demokratie ist der vierte Pfeiler weggebrochen.
Um dies zu verhindern, wollen wir auch selbst einen Ort schaffen, der diesen drängenden Fragen die benötige Zeit und den notwendigen Raum gibt und wir laden alle Interessierten ein, mit uns über die medienpolitischen Gretchenfragen unserer Zeit zu diskutieren: In welcher Öffentlichkeit, mit welcher Medienlandschaft wollen wir in Zukunft – eingedenk der sich abzeichnenden technologischen und ökonomischen Veränderungen – leben? Und was müssen wir heute dafür tun? Wir werden in den kommenden Wochen gezielt Sender, Verleger, Journalist*innen, NGOs und Politiker*innen nach ihren Vorstellungen zu diesen beiden Punkten fragen. Aber auch jeder Leserin und jeder Leser ist herzlich eingeladen die Zukunft zu erfinden. Und nicht vergessen: Geht nicht? Gibt’s nicht!